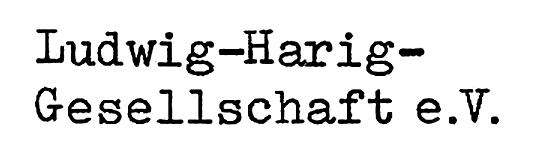Rede von PD Dr. Hermann Gätje
Literaturarchiv Saar-Lor-Lux-Elsass
Universität des Saarlandes
Als wissenschaftlichem Mitarbeiter des Literaturarchivs Saar-Lor-Lux-Elsass und Lehrendem der Neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes ist mir die Beschäftigung der Germanistik mit Ludwig Harig ein besonderes Anliegen.
Dass ich selbst mich seit nun knapp vierzig Jahren mit der Literatur unserer Region wissenschaftlich beschäftige, hängt maßgeblich mit der Lektüre von Ludwig Harigs Roman „Ordnung ist das ganze Leben“ zusammen. Kurz nach seinem Erscheinen habe ich den Roman gelesen, und er hat mein Interesse an saarländischer Literatur geweckt. Eine besondere Anziehung übte der Text auf mich aus, weil seine Schauplätze zum Teil Orte meiner eigenen Lebenswirklichkeit waren, die ich kannte und in Spaziergängen erkunden konnte. Und doch merkte ich auch, dass es ein ambitionierter Roman war, der vergleichbar war mit den von mir gelesenen Generationsgenossen Harigs wie Martin Walser oder Günter Grass. Und so erwuchs das schöne Gefühl, einen bedeutenden Text zu lesen, der – ich wohnte und wohne noch in Dudweiler – vor der eigenen Haustür spielt. Nach dem Besuch eines Proseminars über den Roman habe ich mich einem Kolloquium zur Literatur der Region am Lehrstuhl von Professor Schmidt-Henkel angeschlossen, wo 1978 die Arbeitsstelle für Gustav-Regler-Forschung gegründet wurde und seit 1985 ein Archiv für die Literaturen der Grenzregionen aufgebaut wurde. Ludwig Harig war häufiger in Seminaren von Professor Schmidt-Henkel zu Gast, in meiner Examensprüfung hatte ich Ludwig Harig als Thema gewählt und meine erste eigene Lehrveranstaltung war im Wintersemester 1992/1993 ein Proseminar zu Ludwig Harigs autobiografischen Romanen „Ordnung ist das ganze Leben“ und „Weh dem, der aus der Reihe tanzt!“. Und letztes Jahr widmete sich die erste von mir betreute Examensarbeit dem Motiv der Ordnung in Ludwig Harigs Roman „Ordnung ist das ganze Leben“. Ludwig Harigs Werk ist mir im Laufe meiner Arbeit immer wieder begegnet. Der Nachlass seines Freundes Eugen Helmlé befindet sich in unserem Literaturarchiv und die gemeinsame Übersetzungsarbeit von beiden, besonders bei den Texten von Raymond Queneau ist dort dokumentiert und bietet auch reichlich Stoff für Forschungsarbeiten.
Als Mitarbeiter des Literaturarchivs und selbst Lehrender und Forschender fände ich es natürlich schön und praktisch, wenn sich Ludwig Harigs literarischer Nachlass oder signifikante Teile davon wie der Eugen Helmlés in unserem Hause befinden würde. In meiner eigenen Forschungsarbeit habe ich mich schwerpunktmäßig mit Gustav Regler beschäftigt. Regler und Harig sind vielleicht die überregional bekanntesten saarländischen Autoren und ich glaube, dass vieles, was den der Ludwig Harig vorhergehenden Generation Angehörigen Regler zu einem erkenntnisreichen Forschungsgegenstand macht, auch für Ludwig Harig gilt. Beide haben ihre Zeit in eindrucksvollen autobiografischen Texten gespiegelt. Ich schätze Ludwig Harigs Werk im Ganzen, seine Sprachspiele, seine formgewandten Gedichte, seine einfühlsamen Reisebeschreibungen, seine romanhafte Auslegung Rousseau und vieles mehr, alles bietet Stoff für zahlreiche Forschungsarbeiten. Auf mich haben die beiden erwähnten autobiografischen Romane jedoch den größten Eindruck hinterlassen. In ihnen spiegeln sich persönliche und Zeitgeschichte in besonders eindrucksvoller Weise. In dem Vaterroman „Ordnung ist das ganze Leben“ gelingt es Harig, den persönlichen emotionalen Blick auf den Vater mit dem sachlich historischen romanhaft zu verknüpfen. Der Roman „Weh, dem, der aus der Reihe tanzt“, der Harigs autobiografischen Rückblick auf die NS-Zeit thematisiert und zugleich exemplarisch die ideologische Verführbarkeit junger Menschen analytisch fassbar machen will, ist heute aktueller denn je. Die „Zweiseitigkeit des Menschen“ bildet ein zentrales Motiv in Ludwig Harigs Schaffen, sowohl was die Harmonie (etwa zwei Arme, zwei Beine) als auch die Widersprüche angeht. „Ludwig Harig zwischen Sprachexperiment und autobiografischer Empirie“, dies war seinerzeit die Frage in meiner Examensprüfung und diese gibt mir bis heute noch Stoff zum Nachdenken und steht für mich zentral über Ludwig Harigs Gesamtwerk. Nur scheinbar klingt der Antagonismus nach einem Widerspruch, die Autobiografien bilden immer auch die Suche Ludwig Harigs nach der adäquaten Sprache und ihrer Ordnung bzw. Unordnung ab. Ich glaube, dass gerade die Erforschung dieser Spanne Ludwig Harigs Schaffen für die Germanistik, nicht nur Literaturwissenschaft, auch Sprachwissenschaft, so wertvoll macht.